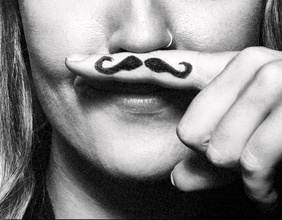Die Romane des George Tabori
"Was ich an seinen Stücken immer bewundert habe, war die ironische Leichtigkeit, mit der er die entsetzlichsten Dinge gefasst hat", sagte Elfriede Jelinek einmal über George Tabori: "Wie Diamanten in Papier, und sie bleiben trotzdem an Ort und Stelle."
8. April 2017, 21:58
George Tabori wurde am 24. Mai 1914 als Sohn jüdischer Eltern in Budapest geboren. Im Alter von 18 Jahren ging er nach Berlin, wo er eine Hotelfachschule besuchte. Die berufliche Laufbahn startete George Tabori als "Aschenbecherputzer" im Berliner Hotel "Adlon", wie er seine damalige Tätigkeit als Page selbst bezeichnet hatte. Nach seiner Rückkehr in die ungarische Hauptstadt arbeitete er als Journalist und Übersetzer, ehe er 1936 nach London emigrierte. Während des Zweiten Weltkriegs, auf der Flucht vor den Nazis, war er Spion.
Als der Krieg zu Ende war, wurde Tabori als Drehbuchautor nach Hollywood geholt. In der Zwischenzeit waren Romane von ihm erschienen, die das Interesse der Film-Produzenten geweckt hatten. Erst relativ spät fand Tabori den Weg zum Theater, dem er sich als Regisseur, kurzzeitig auch als Leiter und sogar als Darsteller von da an ganz und gar verschreiben sollte.
Romane in den 1940er Jahren geschrieben
Als Tabori nicht mehr Spion, aber noch kein Hollywood-Autor war, fiel seine Phase als Romanschriftsteller. Drei Romane entstanden in der ersten Hälfte der 1940er Jahre, ein vierter in seiner Anfangszeit in der Filmmetropole. 1944 erschien in London "Beneath the Stone the Scorpion". Bereits ein Jahr später veröffentlichte der Berner Hallwag Verlag die deutschsprachige Übersetzung mit dem Titel "Unter dem Stein der Skorpion". Der Steidl-Verlag, dem das Verdienst gebührt, Taboris Romane nach und nach wiederentdeckt zu haben, wählte den Titel "Das Opfer". Die Handlung ereignet sich während des Zweiten Weltkriegs. Überraschenderweise schrieb Tabori den Roman – er, der vor den Nazis über den Balkan nach Istanbul und schließlich den Nahen Osten bis nach Kairo fliehen musste - aus der Ich-Perspektive des deutschen Nationalsozialisten.
"Das Opfer"
Ein hoher deutscher Offizier, am Balkan stationiert, nimmt einen englischen Nachrichtenoffizier gefangen. Der deutsche Offizier kann begangene Gräuel nicht vergessen, vorhersehbare nicht ignorieren, er scheitert an der Totalvereinnahmung des Faschismus und wird zum Vollstrecker an sich selbst, während der englische Nachrichtenoffizier die Chance zur Flucht erhält.
Taboris zweiter Roman "Companions oft the Left Hand" galt eine Zeitlang als verschollen. Doch schließlich wurden alte Ausgaben gefunden, unter dem Titel "Gefährten zur linken Hand" erschien Taboris zweiter Roman erstmals 1999 auf Deutsch.
"Gefährten zur linken Hand"
Stefan Farkas ist ein gefeierter Autor von Boulevardstücken. Er selbst hält nicht allzu viel von seiner Literatur. (Farkas erinnert ein wenig an den mit den Taboris bekannten Erfolgs-Autor Molnár, Stichwort "Liliom".) Gegenüber anderen nimmt Farkas gerne die Pose des unbeteiligten Zusehers ein. Er steckt in einer Schreibkrise und bricht im Sommer 1943 in das bis dahin vom Krieg weitgehend verschont gebliebene Adriastädtchen San Fernando auf. Und dann wird auch der Unbeteiligte in die politischen und sozialen Verstrickungen der Kriegswirren hinein gezogen. Farkas, der sich aus allem nur heraushalten will, muss Farbe bekennen und den Preis dafür bezahlen.
Insofern haben alle Romane Taboris einen moralischen Anstrich, es ist jedoch nur ein Anstrich, auf Aufdringlichkeit wird verzichtet.
Wiederentdeckt 1992
Die Wiederentdeckung von Taboris Romanen im deutschsprachigen Raum begann 1992, damals brachte der Steidl-Verlag Taboris dritten Roman "Original Sin", im Original 1946 erschienen, unter dem Titel "Ein guter Mord" heraus. Der dritte Roman läutete das Comeback des Romanciers ein. Der Autor zitiert in der Kapitelunterteilung die Litanei des christlichen Schuld- und Bußbekenntnisses: mea culpa - mea culpa - mea maxima culpa.
"Ein guter Mord"
Tristan Manasse, Besitzer einer Pension in Kairo, wird zum Mörder an seiner Frau. Jenseits des Metaphysischen geht es dem Romanautor Tabori um die Unfähigkeit zu lieben, um Ängste, Sehnsüchte und uneingestandene Begierden.
Taboris vermutlich bester Roman ist sein vierter, wobei auch die andren drei ausgesprochen gut sind, mit dem Titel "Tod in Port Aarif".
"Tod in Port Aarif"
Der Schiffarzt und Chirurg Varga wird vom Gouverneur einer Hafenstadt am Mittelmeer um ärztliche Hilfe gebeten. Patient ist der Gouverneur selbst. Varga macht rasch die Erfahrung, wie verhasst der Mächtige bei Bevölkerung, den Ölgesellschaften, ja sogar in der eigenen Familie ist. Alle warten auf den Tod des Gouverneurs. Varga folgt jedoch seinem ärztlichen Ethos und operiert. Zuerst scheint der Patient gerettet, doch dann treten Komplikationen auf und er stirbt. Vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche im Nahen Osten nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Rückzug der Kolonialmacht England, der arabischen Unabhängigkeitsbewegung und der bevorstehenden Gründung Israels versucht Taboris Held, Varga, sich von den Bedrückungen seiner Vergangenheit zu lösen und sich aus den Widersprüchen der Zeit herauszuhalten, beides misslingt.
Gestalterische Kraft
Taboris Romane sind einerseits hochinteressante Zeitdokumente, in die viel Erfahrungsmaterial des sensiblen und sehr belesen Schriftstellers eingeflossen ist, andererseits spürt man, wer – lektüremäßig - Pate stand: Genet, Malraux, Sartre und vor allem Camus. Dennoch besitzen Taboris Romane eigene gestalterische Kraft, verfügen über originären Zugriff, und sie sind gut lesbar. Taboris erzählerische Dramaturgie macht seine Prosa szenisch und bildhaft; im Prosaschriftsteller steckt bereits der spätere Theatermann.
Im Wagenbach-Verlag erschienen George Taboris Lebenserinnerungen, deren erster Teil, "Autodafé", 2002 herausgebracht wurde und nun mit dem zweiten Teil "Exodus", erstmals aus dem Nachlass veröffentlicht, fortgeführt wurde. Beide Teile befinden sich nun in einem Band.
Autobiografien "Autodafé" und "Exodus"
Im ersten Teil berichtet Tabori von seiner Familie und seinen jungen Jahren in Berlin. Der zweite Teil, auf Deutsch geschrieben, eine schriftstellerische Ausnahme bei Tabori, blieb Fragment. Taboris Erinnerungs-Zug führt bis nach Jerusalem. Wir erfahren manche Details über George Turner, wie Taboris Deckname als Nachrichtenoffizier der BBC lautete.
Alles, was sich danach noch in Taboris Leben ereignete, konnte er nicht mehr aufschreiben. Man hört zwischen den Zeilen Taboris schweren Bassbariton brummen, weder Anekdote noch Witz scheuend. Denn dieser Tragikomiker, dessen halbe Familie in den Vernichtungslagern des Zweiten Weltkriegs umgebracht worden war, hätte wohl anders nicht die Kraft zum Weitermachen gehabt, und irgendwie hatte er es ja tatsächlich geschafft, aus den Katastrophen, die nicht nur seine persönlichen, sondern auch die unseren waren, etwas Hilfreiches zu machen.
Man meint in diesen Lebenserinnerungen den begnadeten Erzähler Tabori selbst zu hören. Und doch kommt etwas hinzu, etwas, was Tabori in all den vielen Interviews und Gesprächen so nicht erzählt hätte: Dafür brauchte es die unerbittliche Kälte des Schreibens und nicht das Augenzwinkern des Anekdotenerzählens: Nach dem Besuch von Auschwitz, wo Taboris Vater Cornelius umgebracht worden war, versuchte sich George Tabori in die Rolle des Abgeklärten zu flüchten, doch dann überschwemmten ihn Vergangenheit, Erinnerung und Empathie und er konnte sich nur noch übergeben.
Service
George Tabori, "Das Opfer", "Gefährten zur linken Hand", "Ein guter Mord", "Tod in Port Aarif", alle Steidl Verlag
George Tabori, "Autodafé", "Exodus", Wagenbach Verlag