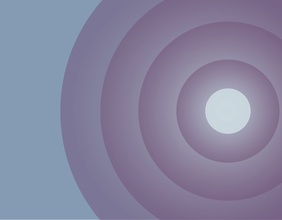US-Hymne wird 200
Sie ist fester Bestandteil jeder offiziellen Feier in den USA, jeder Sportveranstaltung, jeder Schulaufführung - die amerikanische Nationalhymne. "Star Spangled Banner", also "sternenbedeckte Flagge", ist der Name der Hymne, die als Symbol für die amerikanische Unabhängigkeit von Großbritannien gilt. Am Sonntag wird sie 200 Jahre alt.
8. April 2017, 21:58
Mittagsjournal, 13.9.2014
Hand aufs Herz - für Bürger der USA ist das keine auffordernde Floskel, endlich einmal ehrlich zu sein, sondern die reflexhafte Bewegung, wenn die ersten Akkorde von STAR SPANGLED BANNER ertönen: die Hymne der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit 1931 ist es die Nationalhymne, der Text wurde vor genau zweihundert Jahren geschrieben aus Freude über den Sieg der Unabhängigkeit vom britischen Königreich. Die Melodie stammt aber vom Mutterland: ein stämmiges englisches Trinklied.
"Der Raketen roter greller Schein, die in der Luft explodierenden Bomben, gaben uns in der Nacht die Sicherheit, dass unsere Flagge noch da war", heißt es in der ersten Strophe.
Fester Bestandteil des Alltags
Auf jeder Sportveranstaltung, bei jeder Schulvorführung, bei jedem offiziellen Ereignis - Inbrünstig singen die Amerikaner ihre Nationalhymne, hoch erhobenen Hauptes, die rechte Hand auf der Brust.
Die Hymne ist fester Bestandteil des amerikanischen Alltags - und der Inbegriff des amerikanischen Patriotismus: Die Hmyne wurde in einer Zeit geschrieben, als dieses Land noch in den Kinderschuhen steckte, erzählt der Musikhistoriker Michael Blakeslee. damals brauchte man dieses Gefühl des Zusammenhaltes, um die Amerikaner für die Unabhängigkeitskriege zu motivieren.
Am 14. September 1814 schreibt der amerikanische Anwalt Francis Scott Key das Gedicht "Star Spangeld Banner" - eine Ode an die Schönheit der amerikanische Flagge. Seit 1931 ist das Lied die offizielle - und heiß geliebte - Nationalhymne der USA: Amerika ist ein Land, in das Menschen von überall her gezogen sind, auf der Suche nach Freiheit und Demokratie, sagt Blakeslee. die Hymne ist der starke Ausdruck einer gemeinsamen Identität.
Eine Identität, die zahlreiche Künstler und Sänger im Lauf der Geschichte allerdings in Frage gestellt - und damit für Aufregung gesorgt haben. 1969 nimmt Jimmi Hendrix beim Rock-Festival Woodstock die Nationalhymne zum Anlass, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Mit der Gitarre imitiert er Maschinengewehre, Bombeneinschläge und Militärflugzeuge
Unorthodox, nennen ihn empörte Kritiker - und boykottieren ihn ebenso wie den Sänger Jose Feliciano. er verwandelt das Nationallied in eine sanfte Friedenshymne - mit weniger sanften Konsequenzen: Es war ein unglaublicher Tumult, erzählt Feliciano später. Die Leute haben mich mit Schuhen beworfen, ich habe Drohanrufe bekommen, Radiostationen haben aufgehört, meine Lieder zu spielen.
2008 sorgt die Jazzsängerin René Marie für einen Skandal - Bei einer Veranstaltung in Denver vermischt sie die traditionelle Hymne mit einem afroamerikanischen Protestlied: Ich wollte zeigen, was es bedeutet, eine afroamerikanische Frau in den USA zu sein, sagt Marie später - doch für ihre "Schwarze Nationalhymne" wird sie monatelang attackiert.
Eine Hymne für alle Amerikaner, auch für die mehr als 50 Millionen Hispanics in den USA, das ist das Ziel der Künstler Wycleaf Jean, Olga Tanon und Carlos Ponce. Sie veröffentlichen 2006 eine spanischsprachige Version des Star Spangled Banner - das zum Politikum wird. Die Hymne sei in englischer Sprache zu singen, wettern konservative Politiker und bewirken, dass das Lied teilweise abgeändert wird.
Denn bei der Nationalhymne versteht "Das Land der Freien und der Tapferen" offenbar keinen Spaß.