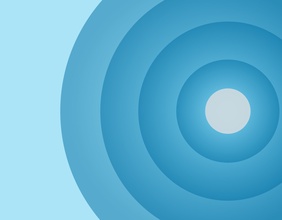Srebrenica: 20 Jahre nach dem Massaker
Srebrenica, die Stadt, in der vor nun mehr 20 Jahren mehr als 8.000 muslimische Bosniaken von den bosnischen Serben in Massenexekutionen getötet wurden. Es ist das größte Kriegsverbrechen auf europäischem Boden nach dem 2. Weltkrieg. Am 11. Juli finden in Srebrenica die großen Gedenkfeiern statt. Doch Srebrenica ist nicht nur ein Name und ein Synonym für Massaker und Genozid. Srebrenica ist eine Stadt, in der weiterhin bosnische Serben und muslimische Bosniaken zusammenleben.
8. April 2017, 21:58
Mittagsjournal, 10.7.2015

Das Massaker von Srebrenica 1995
APA/Margret Schmitt
"Normal" heißt vorsichtig sein
Am Marktplatz in Srebrenica: Es ist sehr belebt. Viele Besucher kommen dieser Tage in die Stadt. Im kleinen Café, neben der Moschee sitzen vor allem alte Männer und beobachten das ungewöhnliche Treiben: Einmal im Jahr, rund um den Srebrenica-Gedenktag, kommt Leben in die ansonsten verlassene Stadt. Vor dem Krieg lebten hier an die 30.000 Menschen, jetzt vielleicht noch 7000. Die eine Hälfte muslimische Bosnianken, die andere Hälfte bosnische Serben.
Wir leben hier normal zusammen, betonen alle, die wir fragen. Normal heißt aber vor allem vorsichtig Nebeneinander.
Es gibt hier auch gute Serben
Was sollen wir anderes tun, sagt Hilmo. 77 Jahre ist er alt, im Krieg wurde fast seine gesamte Familie von bosnischen Serben, meist Nachbarn umgebracht. Es sei schwer für ihn, sagt er. Aber er wolle nicht verallgemeinern. Es gebe hier auch gute Serben. Sein ältester Freund sei übrigens ein Serbe. Er wohne hier um die Ecke. Im Café hier treffen könne er ihn aber nicht, da gebe es zu viele Vorurteile, auf beiden Seiten, sagt Hilmo, aber sie würden immerhin regelmäßig miteinander telefonieren.
"Ciao Efendi"
Vor allem für die ältere Generation sei es schwierig, erzählt uns der Imam der Stadt, Damir Pestalic. Es werde jetzt etwas besser, sagt er, aber als er vor 13 Jahren mit seiner Familie nach Srebrenica gezogen sei, da gab es nahezu keine Kommunikation zwischen den beiden Gruppen. Er habe sich dann aktiv um Kontakt zu den Serben bemüht. Anfangs habe ihn niemand gegrüßt, jetzt spiele er regelmäßig Tennis mit ihnen. Und nun heißt es auf der Straße: "ciao Efendi". Für ihn, als jemand der von außen gekommen sei, sei das wahrscheinlich einfacher. Die Situation in Srebrenica sei besonders heikel. Er kenne keine andere Stadt, wo nach einem Genozid, Opfer und Täter nebeneinander weiterleben müssen, wie hier.
Menschen zweiter Klasse
Für Vater Alexander, den serbischen Popen hier, liegt das Problem woanders. Die Opfer der Muslime würden mehr anerkannt, als die der Serben, dabei hätten die Serben ja auch viele Tote im Krieg gehabt. Viele Serben würden sich hier als Menschen zweiter Klasse fühlen.
So will das die Vizebürgermeisterin der Stadt Biljena nicht bestätigen. In der Stadt sei alles ausgewogen, die Stadtverwaltung paritätisch aufgeteilt zwischen Serben und Bosniaken. Der Bürgermeister ist Muslim, sie als Vizebürgermeisterin Serbin. Im Zusammenarbeiten sehe sie keine Probleme. Sie trinke auch Kaffee mit den anderen, betont sie. Doch sobald das Gespräch auf das Massaker von Srebrenica kommt, poche auch sie auf die eigenen serbischen Opfer. "Ich verstehe, dass am 11.Juli viele Bosniaken hierherkommen, um der Opfer zu gedenken, ich habe auch Mitleid, aber man muss auch verstehen, am 12. Juli gedenken wir Serben unserer Opfer."
Lichtblick FC Gubor
An den Gedenkfeiern für die Muslime wird die Vizebürgermeisterin nicht teilnehmen und auch sonst keine Serbe hier aus Srebrenica. Der Nationalismus ist wie ein Fluch, sagt Mujo. Mujo ist Bosniake, er will mit den Serben zusammenleben, die Vergangenheit vesucht er zu verdrängen, wie die meisten hier.
Doch die Politiker beider Seiten würden die Wunden immer wieder aufreißen. Sie schüren den Nationalismus, die Ressentiments. Damit würden sie sich ihre eigenen Pfründe sichern. Hinter den Kulissen würden sie zusammen arbeiten, sich den Kuchen teilen. Die Bevölkerung ziehe den Kürzeren, sagt Mujo. "Die Menschen sollten das endlich durchschauen. Sie sollten nicht mehr mit sich spielen lassen, sondern gemeinsam etwas schaffen." Der Lichtblick für die Männer hier: die Fussballmannschaft FC Gubor, nach dem Krieg wiederbelebt. Gemeinsam spielen hier die jungen Männer von Srebrenica, Bosniaken und Serben zusammen, mit dem gemeinsamen Ziel, wie sie betonen, in die nächste Liga aufzusteigen.