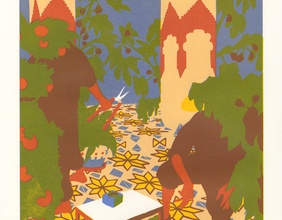Kunstbetrieb als Geldmaschine
Regelmäßig sorgen bildende Künstler von Gerhard Richter bis Jeff Koons für neue aberwitzige Auktionsrekorde. Der zeitgenössische Kunstbetrieb hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer veritablen Geldmaschine entwickelt. Der deutsche Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich beleuchtet dieses Phänomen in seinem heuer erschienenen Buch "Siegerkunst" kritisch.
8. April 2017, 21:58
Für heute Abend hat ihn der Kunstkritikerverband AICA zu einem Podiumsgespräch ins Kunst Haus Wien geladen.
Morgenjournal, 09.08.2016
Die ultimative Luxuserfahrung
Unter "Siegerkunst" versteht Wolfgang Ullrich "Kunst von Siegern für Sieger". Superreiche kaufen von Künstlern, die selbst superreich und mächtig geworden sind. Siegerkunst ist unsinnig teuer, und genau deshalb so sexy. Absurd hochpreisige Kunst zu besitzen, statt sie nur im Museum betrachten zu können: das verschafft die ultimative Luxuserfahrung. Siegerkünstler sind teils selbst Unternehmer. Manche wie Olafur Eliasson oder Damien Hirst beschäftigen in ihren Ateliers hunderte Leute.
Anderes Rollenbild als Künstler der Moderne
"Äußerlich gesehen macht es einen Künstler zum Siegerkünstler, wenn er eben nicht mehr das Bild des Künstlers erfüllt, das in der Moderne gang und gäbe war: der Bohemien, der notorisch kein Geld hat, der sich am Rand der Gesellschaft sieht und in gewisser Weise auch wieder ein Privileg hat, nämlich einen unbeschwerten freien Blick auf die Gesellschaft werfen kann. Das kann, würd‘ ich sagen, ein Siegerkünstler nicht mehr. Er ist so sehr im Zentrum der ökonomischen Macht, auch der Statusmacht angekommen, dass er eigentlich ein ganz anderes Rollenbild zu erfüllen hat", sagt Wolfgang Ullrich.
Nicht unbedingt glatt
Siegerkunst ist nicht unbedingt dekorativ und glatt. Sie kann auch schockieren, oder aus trashigen billigen Materialien bestehen wie die Riesen-Labyrinthe von Thomas Hirschhorn aus Pappe, Klebeband und Verpackungsfolien. Und sie kann verwirrend rätselhaft sein. Umso mehr wird sich der Sammler als Insider präsentieren können. "Weil eben diejenigen, die diese Kunst besitzen, damit Eingeweihtheit signalisieren - ein Zugang, der anderen imponiert, der vielleicht auch einschüchternd wirkt", so Ullrich.
Wenn Künstler das Repräsentationsbedürfnis von Käufern und Auftraggebern bedienen, kann trotzdem große Kunst entstehen. Die alten Meister arbeiteten für Adel und hohen Klerus; ein Goya oder Velazquez verpackten selbst in Hofporträts kritische Analysen der Hofgesellschaft. Mit dem Aufkommen der Siegerkunst müssten nun Künstler neu lernen, wie sie ihren Auftraggebern gefallen, ohne sich anzubiedern, so Ullrich.
"Raffinierte Arbeit" von Damien Hirst
Er spricht aber Siegerkünstlern nicht pauschal die hohe Qualität ab. Damien Hirst gilt vielen als Inbegriff eines Kunstmarktprofiteurs, der angeblich die Kunst verrät; mit Werken wie dem Diamant-besetzten Totenschädel. Wolfgang Ullrich sieht manches von Hirst kritisch. Aber beim Totenschädel hat er den Eindruck, dass Hirst hier gerade den Geldexzessen des Kunstbetriebs den Spiegel vorhält:
"Ein Memento Mori, ein Vanitas-Symbol, ist hier schon sehr stark. Auch die Vergänglichkeit von Reichtum, die Vergänglichkeit auch dieser extremen Preise für Kunst wird damit plötzlich als Thema sehr sinnfällig. Insofern finde ich das eigentlich eine sehr raffinierte und kluge Arbeit."
Differenziertes Buch
Mehr als den Künstlern liest Ullrich Kollegen die Leviten: Viele Kritiker ließen sie sich "von den eitlen Launen einiger Fondsmanager, Unternehmer, reicher Erben und Celebrities vorgeben, worüber sie schreiben und forschen" - nämlich über Siegerkunst zu Rekordpreisen. Das differenzierte Buch zu diesem Thema ist bei Wagenbach erschienen; heute im Kunst Haus Wien diskutieren Sabine B. Vogel und Matthias Dusini mit dem Autor Wolfgang Ullrich.
Service
Wolfgang Ullrich, "Siegerkunst - Neuer Adel, teure Lust", Wagenbach
Kunst Haus Wien - Diskussionsabend mit Prof. Dr. Wolfgang Ullrich. Dienstag, 9. August, 19 Uhr