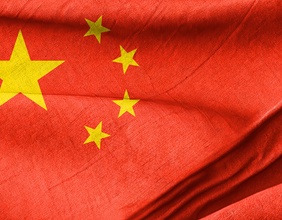Ö1 Kunstgeschichten
"Besuche bei Madonnen" von Michael Dangl
St. Petersburg, Florenz, München: ausgehend von der "Madonna Benois", deren Geschichte Michael Dangl in Sankt Petersburg nachspürt, führt die Betrachtung dreier Madonnengemälde von Leonardo da Vinci in Städte und Museen dreier Länder. Es ist zugleich eine Zeitreise durch die Jahrhunderte, und die Reflexion künstlerischer Ideale in einer fragilen Gegenwart. Die von Edith-Ulla Gasser kuratierte Erstveröffentlichungsreihe "Kunstgeschichten" widmet sich dem Kunstblick von Autorinnen und Autoren.
5. Juni 2022, 05:00
"Ich habe zwei Jungfrauen Maria angefangen", schreibt der sechsundzwanzigjährige Leonardo, Notarsohn aus Vinci. Da hatte er seinem Meister Verrocchio die Lust an der Farbmalerei bereits verdorben. Dessen "Taufe Christi" war gut - der von seinem Schüler hineingemalte Engel aber das Werk eines Genies. Verrocchios Werkstatt war führend im Florenz der Medici und baute den Mächtigen unter anderem Umzugswagen für ihre Feste.
Die Medici waren Abkömmlinge von Geldwechslern. Politische Macht brauchten sie, um das Vermögen ihrer Bank abzusichern. Zur Schau gestellter Luxus, heißt es, sollte davon ablenken. Kriege gegen andere italienische Staaten, Machtkämpfe innerhalb der Stadtmauern wurden nicht nur mit Waffen geführt. Kunst, Poesie und Gelehrsamkeit durften erblühen, um Brutalität und Geldgier ein nobleres Ansehen zu geben. So urteilen die Jahrhunderte danach.

MARIA FRODL
Michael Dangl, geboren 1968 in Salzburg, ist Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt und bekannt aus Fernsehserien und Radioproduktionen. Seine markante Stimme ist dem Ö1 Publikum seit vielen Jahren vertraut, und auch als Autor von Prosa und Hörspielen ist der Schauspieler dem Kultursender verbunden. Im Literaturverlag Braumüller erschienen von ihm zuletzt der Roman "Orangen für Dostojewksij" und der Lyrikband "Hymnos an den Süden". Eine seiner Informationsquellen für die Ö1 Kunstgeschichte war das Buch "Leonardo. Der Mann, der alles wissen wollte" von Bernd Roeck.
Der Schnee knirscht unter meinen Schritten in der vornehmen "Dritten Linie" der Sankt Petersburger Wassiljewskij-Insel, wie er mir in Städten seit meiner Kindheit selten geknirscht hat. Zum Knirschen braucht es Massen von Schnee, die richtige Mischung aus flockig und fest, Kälte, Sonnenschein. Hell ist es wie selten im Dezember. War es nicht so, denke ich, dass mit der Renaissance die Sonne des Humanismus über der Menschheit aufgegangen ist? Zählt es, dass Cosimo di Medici sich als "Klienten" Gottes sah und eine Kirche errichten ließ, um sein Konto mit dem "Patron" auszugleichen, wenn wir ein halbes Jahrtausend später die Basilica San Lorenzo bewundern?
Florenz war gläubig. Maria wachte als Bild oder Statue in jedem Haushalt, auf Altären und Fassaden über die ganze Stadt. Massenware entstand. Aber die Großen des Fachs wurden erkannt - und reich entlohnt. Leonardo galt schon als solcher, als Skizze um Skizze von Gottesmutter und Kind zur "Madonna mit der Blume" reifte, dem Gemälde, das vor nun zweihundert Jahren nach Russland gelangte und von einem Kaufmann aus Astrachan am Kaspischen Meer seiner Tochter als Mitgift zu ihrer Heirat mit dem Architekten Leonti Benois geschenkt wurde. Das Bild hing fortan im Petersburger Stadthaus der aristokratischen Künstlerfamilie auf der Wassiljewskij-Insel und wurde 1909 in einer Ausstellung ohne Angabe der Autorenschaft gezeigt. Der Archivar der zaristischen Museen erst soll es als echten Leonardo identifiziert haben.
"Stimmt nicht", sagt Anastasija Benois. Die Ururenkelin des Architekten empfängt mich um zehn Uhr am Vormittag im langen Abendkleid. Als Freund der Familie gewährt sie mir in ausländerhöflich deutlichem und langsamem Russisch eine Privatführung durch die als Museum eingerichtete Wohnung, die zugleich Salon für Konzerte und literarische Soireen ist. "Man hat immer gewusst, dass es ein Leonardo ist", sagt sie trocken und steckt die Kopie zurück in die Mappe. Selbst diese hat sie nur kurz gezeigt, gerade so lange, dass mir die kindliche Fröhlichkeit der Gottesmutter aufgefallen war. Das Original hängt in der Eremitage, für die es Zar Nikolaus II. von Benois kaufte. Benois' Vorfahr war ein Hofkoch, vor der französischen Revolution nach Russland geflohen und dort für seine Künste geadelt. Leonti Benois, Errichter von Kirchen, Palästen und Prunkbauten in ganz Europa, verlor Haus und Landgüter in der russischen Revolution, drei Jahre nach 1914, als die "Madonna mit der Blume", das bis dahin am teuersten verkaufte Gemälde der Geschichte, einen neuen Besitzer bekam, vom alten aber den Namen behielt: als "Madonna Benois" wurde und ist sie weltberühmt.
Die Sonne fällt durch hohe Fenster auf edle Hölzer, Tapeten, Fauteuils. "Die Sonne bewegt sich nicht", liest man überrascht (in außergewöhnlich großen Buchstaben) in Leonardos Notizbüchern. Vierzig Jahre vor Kopernikus’ epochaler Veröffentlichung konnte er diese Erkenntnis eigentlich noch nicht haben. Möglich, dass es bloß eine Szenenanweisung für eines seiner Bühnenbilder bei Hoffesten war, in der auch die Gestirne ihren Platz hatten.
Mitte Januar sticht die Sonne in die weiten Amtskorridore der Florentiner Uffizien. Während in die Newa Eislöcher gehackt werden zum rituellen Bad am orthodoxen Tauffest, trägt der Arno keine Eisbrecher, sondern Sportkanus. Am rechten, sonnenbeschienenen Ufer ergehen sich Maskierte ohne Karneval. Ihre Augen sind ernst. Der Ausblick von der Gemäldegalerie ist ein Gemälde für sich. Die Florentinerinnen zur Zeit da Vincis gingen zu Malern, um sich mit Ölfarben schminken zu lassen; im Florenz der Renaissance gab es mehr Bild- als Fleischhauer. Die Künstler begannen langsam, sich aus der Zunft der Handwerker zu lösen, zu der sie seit dem Mittelalter noch gehörten. Doch nur den wenigsten erfüllte sich der Traum, bei Hof zu arbeiten, im direkten Umkreis der Mächtigen viel Geld zu verdienen, Privilegien, Straf- und Steuerfreiheit zu genießen. All dieser Vorrechte - inklusive eines eigenen Weingartens - durfte sich gewiss sein, wer mit zwanzig ein Meisterwerk wie die "Verkündigung" schuf.
Sanft sind die Figuren, introvertiert, der Engel in seiner Geste der Segnung, die Jungfrau in der Verwunderung über den Besuch. Der Maler tut alles, um sie in dem mehr als zwei Meter breiten Bild weit voneinander entfernt wirken zu lassen: der Bote links auf dem Rasenteppich kniet vor Bäumen, Himmel, weiter Landschaft in "seinem eigenen", von der Natur bestimmten Teil der Szene, die im Lesen Aufgeschreckte scheint ganz dem Häuslichen zugehörig, von Mauern eingerahmt, gar ein Blick in ihre Schlafkammer wird gewährt. Ein Bergmassiv im Hinter-, ein Marmortisch im Vordergrund trennen die Bereiche optisch noch mehr - als müsste jede vermeintliche Nähe zwischen Himmlisch und Irdisch vermieden werden. Die vom Buch Aufschauende hat gar den Kopf halb abgewandt vom Verkündiger, der hält seinen demütig gesenkt wie jemand, der direkten Blick scheut. Erst, als der meine lang genug auf ihm weilt, fällt mir auf, wie steil seiner in dem geneigten Gesicht nach oben gerichtet ist (das dadurch plötzlich etwas Kühnes bekommt).
Ich denke mir eine Linie und treffe genau auf die Augen der Muttergottes, deren rechtes - ich sehe es erst jetzt - klar und gerade und weniger überrascht, als es ihre Körperhaltung ausdrückt, der Prophezeiung ihrer Freude und ihres Leids entgegensieht. Ihr rechtes, denn als ich ihre Gesichtshälften gesondert betrachte, offenbart sich die mir zugewandte linke als die eine Kindes, unschuldig, rein, die rechte hingegen reifer, älter, wissenden Blicks. Jungfrau und Schmerzensmutter - beides trägt ihr Wesen schon in sich. Und sosehr die zwei Figuren getrennt scheinen, stehen sie in geheimem, nicht offensichtlichen Zusammenhang. Maria und Gabriel sind in einem Dialog; Göttlich und Menschlich sind Aug in Aug, verstehen, berühren einander auf eine subtile, innerliche, mehr gefühlte als rational fassliche Art. Und so, dass der flüchtige Betrachter es gar nicht wahrnimmt. Diese "Verkündigung" trifft mich so, dass ich zwei Stunden durch die Gassen der Florentiner Innenstadt treibe, ehe ich irgendwo zum Anlegen komme.

GEMEINFREI
Madonna mit der Nelke von Leonardo da Vinci
Die politischen Seiten zu wechseln, denke ich zweieinhalb Monate später, über den Münchner Königsplatz gehend, wo die Nazis Aufmärsche abhielten und Bücher verbrannten, war Fürstendienern wie Leonardo kein Problem. Der feinsinnige Genussmensch, beliebte Gastgeber, gerühmt als bester Stegreifdichter seiner Zeit, nannte den Krieg "völlig bestialischen Wahnsinn" - und empfahl sich zugleich seinen wechselnden mörderischen Herren (wie Ludovico Sforza und Cesare Borgia) zunächst ausschließlich als Erfinder teuflischer Waffen: von Sprengstoffen, Schnellfeuergewehren, Kanonen, Orgelgeschützen, einem mit rotierenden Sicheln versehenen Wagen, der Feinden die Glieder absäbeln sollte, dem ersten Panzer und, ein Prototyp der biologischen Kriegsführung, Stinkbomben aus gegärten Exkrementen, Rüben und Kohl. Nach den sehr einseitig angelegten Maßstäben der Gegenwart müssten alle Schöpfungen des Leonardo da Vinci aus den Museen der Welt verbannt werden.
"Das Original sehen", wirbt die Alte Pinakothek, und wirklich offenbart mir die "Madonna mit der Nelke", zu der ich nach dem Passieren zahlreicher Schlachtengemälde anderer bekannter Künstler gelange, was auf keiner Reproduktion so deutlich wird: die Augen des babyspeckigen Jesuleins, das spielerisch nach der Blume in der Hand der Mutter greift, erzählen ihre eigene Geschichte. Sie tragen die Schrecken der Zukunft - der eigenen wie, da sie auf uns gerichtet sind, der unseren in sich. Es sind Augen voll von Leonardos "Prophezeiungen von der Grausamkeit des Menschen": "Oh Welt, wie kann es sein, dass Du dich nicht auftust und so große Schurken in deine tiefen Klüfte und Höhlen stürzt und dem Himmel ein so grausames, unbarmherziges Monster nicht mehr zeigst?" Es sind Augen, die die Apokalypse sehen, Augen - im Körper des Kindes - eines alten Menschen, verbittert, desillusioniert, ohne Hoffnung. In einem Gemälde voll Schönheit und Harmonie.
Punkt zwölf setzt am Chinesischen Turm im Englischen Garten die Bayerische Blasmusik ein. Marschmusik, dafür komponiert, Gängen in die Schlacht, in den Krieg, in den Tod ein festliches, fröhliches Gepränge zu geben. Die Aprilsonne fällt wärmend durch die Blätter der Kastanienbäume und Kirschblüten.
Wenige Tage darauf bin ich wieder in Russland. Seit meinem letzten Besuch sind Gräben zwischen den Ländern entstanden, tief und furchtbar. Im karelischen Grenzland singt der Wind in den Stahlträgern der finnischen Zollgebäude, steht lange eine im fernen Westen untergehende Sonne. "Il sole nó si muóve." Hundegebell und sonst Stille. Wälder, Schnee.
Auf dem Platz vor dem Winterpalast spielt eine Militärkapelle. Ich besuche das Foyer des Eremitage-Theaters, von Leonti Benois im Rokokostil dekoriert. Hohe französische Fenster gehen auf Newa und Winterkanal.
1478, als Leonardo von den zwei begonnenen Madonnen berichtet, hat Lorenzo de Medici gerade ein Attentat überlebt (nicht so sein Bruder) und sich gründlich an den Verschwörern gerächt. Sie wurden aus Fenstern geworfen, gevierteilt, ihre Köpfe trieben, bespöttelt vom Volk, den Arno hinunter. Bald waren die Feinde der Medici tot oder im Exil. Leonardo zeichnet einen der Gehenkten, stellt wächserne Votivbilder für den Herrscher her - und setzt den Pinsel an die Madonna, die heute "Benois" heißt.

GEMEINFREI
Madonna Benois
Der Raum ist abgedunkelt. Schulklassen paradieren vor der keinen halben Meter hohen Leinwand, deren Sujet unaufgeregt ist, friedvoll. Eine häusliche Szene. Mutter und Kind. Kümmern sich um keinen Betrachter. Die Mama ist jung, ein Mädchen, eher die Schwester oder die Njanja, das Kindermädchen des pastagenährten Nackerpatzls, das in der kreuzförmigen Blüte in beider Hände mehr erkennt, voraussieht als seine Spielgefährtin. Der wissenschaftliche Ernst des Kindes spiegelt Leonardo selbst, der sich ein ganzes arbeitsreiches Leben lang seine Kindlichkeit bewahrt haben soll, "weitergespielt hat", wie Freud meinte. Das Bild gilt als Fragment, doch ich frage mich, ob die Abwesenheit der üblichen Landschaft im Fensterausschnitt über Jesus’ kahlem Haupt, das "nichts als Himmel" nicht genau das ist, was erzählt werden soll. Der Meister, der Malerei "stumme Dichtung" nannte, wollte, dass sich beim Betrachter dieselben Emotionen regen wie in den Figuren. Nichts lenkt ab von deren intimem Dialog, stiller Freude, wachem Ernst, Spiel und Aufgabe, und ein wie wartend weiter, heller Himmel sich lichtender Wolken.
Erst schöpferische Arbeit machte für Leonardo den Menschen aus. Sonst seien Gottes Kreationen allein "Nahrungssäcke" und "Durchgang für Kot". Außer "gefüllten Latrinen", forderte er, sollte von ihrem „elenden Leben“ irgendeine Erinnerung im Geist der Sterblichen bleiben. Und er, der Mensch und Welt so genau angeschaut, durchschaut, so tief untersucht und präzise abgebildet hat wie kein Einzelner vor und nach ihm, der neben Kriegsapparaten Musikinstrumente schuf (wie eine Flöte, die "nach Art der menschlichen Stimme" Glissandi hervorzubringen vermochte, gleichsam ein "akustisches Sfumato") und der Menschheit den Traum vom Fliegen zur Erfüllung bringen wollte: er selbst weinte vor seinem Tod und bereute, wie sehr er "Gott und die Menschen beleidigt" hatte, weil er in seiner Kunst "nicht so verfuhr, wie es sich gehörte". Späte Zeichnungen beschwören Wasserfluten herauf, brennende Städte, brechende Wälder.
Um punkt Zwölf donnert der tägliche Kanonenschuss über die Stadt, über den Fluss von der Peter-und-Paul-Festung herüber, wo der letzte Zar begraben liegt, Nikolaus II., im Jahr 2000 heiliggesprochen, Käufer und Bewahrer der Madonna Benois. Kurz erschauert, erstarrt alles in der harten Wirklichkeit des Kanonenschlags.
Nichts schien dem Mann aus Vinci unwichtig. Einzig über Amerika, die sensationellste Entdeckung seiner Zeit, verlor er kein Wort. Das zählt zu den großen Rätseln seiner Biografie.
Der späte Leonardo glaubte, dass sogar die Intervalle zwischen zwei Herzschlägen den Gesetzen musikalischer Harmonie folgten. Dass auf allem ein Abglanz der absoluten Schönheit des nach Maß und Zahl geordneten Universums liege. Seine vielleicht letzte Kohleskizze zeigt eine "Frau in einer Landschaft", die dem Betrachter den Weg weist. Ist sie Matelda? In den finalen Gesängen der "Göttlichen Komödie" geleitet sie Dante lächelnd durch den ewigen Frühling des irdischen Paradieses, von wo er aufsteigen wird zu den Sternen. Die Wasser der Lethe lassen ihn alles vergessen. Ein Schluck der Eunöe erinnert ihn an alles Gute, das er getan hat.
Das Eis in den Kanälen ist geschmolzen. Die Tage werden länger. An den Ufern necken sich Verliebte. "Der Frühling", so sagt es ein Maler aus dem Heute, David Hockney, "der Frühling lässt sich nicht canceln."


![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/|CC BY-SA 4.0] Die Verkündigung Mariae, L’Annunciazione Leonardo da Vinci und Andrea del Verrocchio (Ausschnitt)](/i/intro/6b/99/6b99886c3029287878a5665f685c2e719fb8d378.jpg)
![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/|CC BY-SA 4.0] Die Verkündigung Mariae, L’Annunciazione Leonardo da Vinci und Andrea del Verrocchio (Ausschnitt)](/i/related_content/6b/99/6b99886c3029287878a5665f685c2e719fb8d378.jpg)