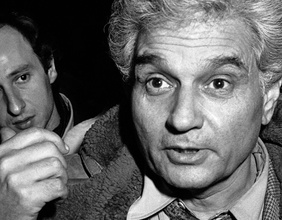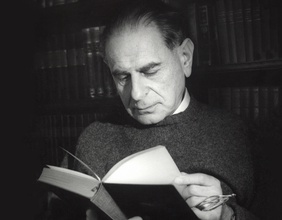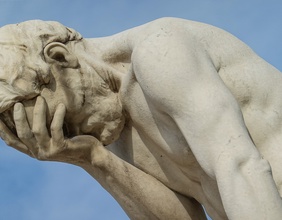AP/IKONI/ROBIN HEIGHWAY-BURY
Radiokolleg
Eine Kulturgeschichte des Spuks
Von Gespenstern und Geistern - die von Verstorbenen und die der Vergangenheit, von den ersten, schriftlich festgehaltenen Geistererscheinungen in Mesopotamien über die Hochblüte des Geisterglaubens im rationalistischen 19. Jahrhundert bis zur kulturkritischen "Hauntologie der Gegenwart".
12. Dezember 2022, 02:00
Die langen Nächte im Herbst und Winter sind traditionell die Zeit der Geister und Gespenster. Einen Höhepunkt findet der zeitgenössische, wenn auch meist nicht ganz ernst gemeinte Geisterglaube alljährlich in Halloween, das sich aus dem irisch-keltischen Totenfest Samhain entwickelt hat und durch die Ausstrahlung amerikanischer Populärkultur auch in unseren Breiten immer beliebter wird.
Doch Geister und Gespenster gehen zu allen Jahreszeiten um - und auch zu allen Zeiten. Bereits in Mesopotamien wurde auf Tontafeln und in Keilschrift von Begegnungen mit ihnen berichtet. Und auch aus dem antiken Rom sind, etwa von Plinius dem Jüngeren, einige gruselige Gespenstergeschichten dokumentiert.
Hochblüte des Geisterglaubens im 19. Jahrhundert
Interessant und etwas paradox ist die Hochblüte, die der Glaube an Geister und Gespenster im 19. Jahrhundert erlebte - in einem Jahrhundert, das als besonders rationalistisch gilt. Doch gerade weil es zu jener Zeit zu beispiellosen naturwissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Erfindungen kam, die bis dahin im Verborgenen wirkende Naturkräfte plötzlich sichtbar und hörbar machten - wie in Funkverkehr und Fotografie -, vermuteten nicht wenige damals, dass man mit wissenschaftlichen Methoden und Apparaten auch einen Kontakt zum Jenseits herstellen könne. Zu diesen „Spiritisten“ zählte auch Arthur Conan Doyle, Schöpfer der Figur des stets kühl kalkulierenden Vernunftmenschen Sherlock Holmes.
Conan Doyle war auch Mitglied im Londoner Ghost Club, der sich die Erforschung von Geistererscheinungen auf seine Fahnen geschrieben hatte. Mit Charles Dickens war ein weiterer hochkarätiger Schriftsteller Mitglied in diesem Klub. Von Dickens stammt auch eine der bis heute bekanntesten Geistergeschichten, die 1843 entstandene Erzählung A Christmas Carol. Darin ließ er die Figur des reichen Geizhalses Ebenezer Scrooge, später Vorbild für Walt Disneys Dagobert Duck, auf Geister aus seiner Vergangenheit treffen - die ihn schließlich eines Besseren belehren.

Ebenezer Scrooge aus "A Christmas Carol"
AP/JOEL RYAN
Dickens nutzte dabei die Form der Geistergeschichte in erster Linie als Vehikel zur Sozialkritik. Zugleich erfüllen seine Geister aber die klassischen Vorgaben: Es sind Verstorbene, die in körperloser oder nur mehr schemenhafter Form aus dem Jenseits zurückkehren und mit Lebenden in Kontakt treten.
Im Banne der Geister der Vergangenheit
Der pseudowissenschaftliche Geisterglaube der Spiritisten im 19. Jahrhundert mit seinen seltsam anmutenden Apparaturen hat Mitte der 1980er Jahre ein spätes, satirisches Echo in der Filmkomödie Ghostbusters gefunden. Und auch sonst gehen in der Film- und Popkultur gern die Gespenster um. Der englische Kulturtheoretiker Mark Fisher hat in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob unsere Kultur und Gesellschaft nicht allgemein zu sehr im Banne der Geister der Vergangenheit stehen - und daher keine Vorstellung von der Zukunft mehr entwickeln und keine Fortschritte mehr machen können.

Ghostbusters!
ORF/SONY PICTURES
Zur Beschreibung dieses Phänomens verwendete Fisher den Begriff „Hauntologie“, der ursprünglich vom französischen Philosophen Jacques Derrida stammt und sich wortspielerisch aus dem englischen Wort für Spuk und dem Begriff Ontologie, der Lehre vom Seienden, zusammensetzt. Während Derrida mit seiner Hauntologie nur über das weitere Herumgeistern der Ideen von Marx nach dem Scheitern des Marxismus nachdachte, übertrug Mark Fisher diesen Begriff in den 2010er Jahren auf die westlich geprägte Moderne insgesamt - und ihre zerschellten Zukunftsentwürfe.
Gestaltung: Richard Brem
Gestaltung
- Richard Brem