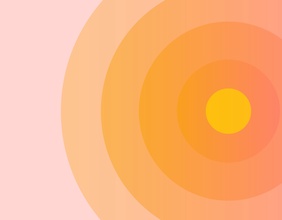Europäische Stadt in Südamerika
Aufbruch in Buenos Aires
Argentinien erlebte im Jahr 2001 den ökonomischen und sozialen Zusammenbruch. Das Volk übte den Aufstand. Vier Jahre danach gehen die Wirtschaftszahlen wieder stetig nach oben. Vorsichtig spricht man in Buenos Aires von einem Frühling nach dem Crash.
8. April 2017, 21:58
Ciudad de Buenos Aires, die Elf-Millionen-Metropole. Modern und charmant, elegant und weltgewandt. Eine Stadt, eingehüllt in einen Schleier aus Nostalgie. In keinem Stadtteil der Metropole vergisst man auf das Geschichtsträchtige zu verweisen. Auf die sechs Millionen europäischer Immigranten, die sich vor etwa 100 Jahren in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ansiedelten.
Freilich werden auch Klischees bedient wie das vom "Paris Lateinamerikas", dem Tourismus kommt das zu Gute. Unzählige Europäer und US-Amerikaner nutzen die Gunst der Stunde, denn nie zuvor war die tangogeschwängerte Metropole - wegen der noch vor kurzem rasenden Inflation von 4.000 Prozent! - so günstig gewesen. Argentinien hofft natürlich nicht mehr lange. Ein Streifzug.
In Downtown Buenos Aires stehen die höchsten Gebäude:
Im Hafen am Rio de la Plata
Diese beiden Herren von der Comision Binacional Puente Buenos Aires Colonia warten seit vielen Jahren, dass endlich die 42 Kilometer lange Brücke, die längste der Welt, über das Fluss-Delta nach Uruguay gebaut wird. Es fehlt nur mehr die politische Entscheidung.
Frischer Wind
Die Aufbruchstimmung in Buenos Aires kann man in einigen Stadtteilen, vor allem in Palermo, an seiner neuen Architektur ablesen. Das aufstrebende Architektur-Büro PAC repräsentiert diesen Aufbruch. PAC steht für "produccion architectura contemporano".
Die andere Seite von Buenos Aires
Als 2001 die Wirtschaft zusammenbrach, waren Tausende plötzlich arbeits- und in vielen Fällen mittellos. Mehr als 20.000 Menschen sammeln in der Stadt seither Papier und Kartons aus dem Müll und von der Straße und verkaufen das Gut an Recycling Firmen. Man nennt sie die "Cartoneros".
Was den Kubanern ihr Che, ist den Argentiniern ihr Säulenheiliger des Tango, Carlos Gardel.
Großes Sicherheitsbedürfnis
Für viele halbwegs betuchte Argentinier sind "Countries" ein Stück Land im Himmel, das man sich kaufen kann. Countries sind abgeschlossene, ghettoartigen Siedlungen, Städte in der Stadt, mit privatem Geld erbaut - so genannte "Gated Communities". In Buenos Aires gibt es mehr als 400, das größte ist 1.600 Hektar groß.
Eines der zugkräftigsten Argumente für ein solches Leben ist der hohe Freizeitwert, denn fast immer gehören zur Infrastruktur der Wohngebiete Clubhaus, Golfplatz, Reitschule, Schwimmbad und Tennisplätze. Der zweite, in den letzten Jahren wichtigere Grund für das Wohnen im umzäunten grünen Paradies, ist die Sicherheit. Das Country bietet der betuchten Mittelschicht und den Reichen Schutz vor einer immer aggressiveren Umwelt.
Zeugnis spanischer Architektur
Orientierung ist in der Ciudad de Buenos Aires kein Problem. Die Stadt ist zwar riesig, aber einfach aufgebaut und hat Ähnlichkeiten mit dem Straßenraster Manhattans.
Das Bild von der europäischsten Stadt Lateinamerikas kommt nicht von ungefähr:
Bunte Häuschen in Boca
Der Stadtteil La Boca ist ein dem Meer abgewonnenes Stück Stadt-Landschaft und heute ein Mythos.
Boca ist wegen seiner bunt bemalten Blechhäuser und seiner Geschichte als Wohnviertel der Immigranten, der Genueser Matrosen und Dockarbeiter im 19. Jahrhundert berühmt geworden. Es war eine erste Anlaufstelle, das Ellis Island von Buenos Aires sozusagen. "La Boca" bedeutet deshalb soviel wie "Maul" oder "Mündung".
In Boca entstand auch der Tango, den die italienischen Immigranten mitgebracht hatten. Für den argentinischen Schrifsteller Jorge Luis Borges war Boca ein äußerst seltsamer Stadtteil: "Der einzige Punkt in Buenos Aires an dem nichts so ist wie in Buenos Aires üblich."