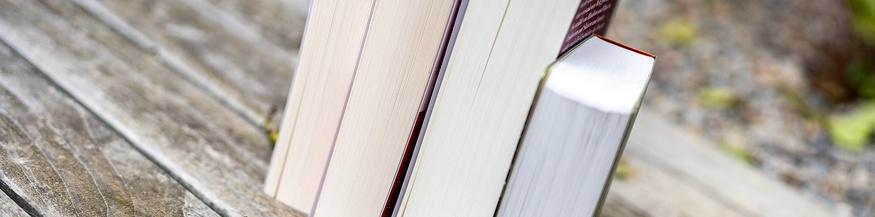Mensch und Roboter
Bruder Blech
Das tschechische Wort "Robot" bedeutet Arbeit, Fronarbeit oder Zwangsarbeit. Als Karel Capek 1920 den Begriff für sein Theaterstück "R.U.R." mit einer neuen Bedeutungsebene versah, so tat er das vor dem Hintergrund der industriellen Automatisierung.
8. April 2017, 21:58
Als Karel Capek - auf Anregung seines Bruders Josef - 1920 den Begriff "Robot" für sein Theaterstück "R.U.R. (Rossum's Universal Robots)" mit einer neuen Bedeutungsebene versah, so tat er das vor dem Zeithintergrund der industriellen Automatisierung und der um sich greifenden Fertigung am Fließband.
Der seiner Arbeit entfremdete Mensch am Fließband wird gewissermaßen durch einen Doppelgänger aus Blech, Metall oder Kunststoff ersetzt. Der Roboter lässt sich vor diesem Hintergrund auch als Figur des Fordismus verstehen.
Eine Geschichte von Klassenkämpfen
Zum Zeithintergrund von "R.U.R." gehört auch die Russische Revolution, die eindrucksvoll das Marx'sche Theorem zu bestätigen schien, "dass alle menschliche Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen" sei. Eine Gesellschaft oder eine Gesellschaftsschicht gelangt zu Wohlstand, indem andere Gesellschaften oder andere Gesellschaftsschichten ausgebeutet oder gar als Sklaven gehalten werden. Bis diese rebellieren. Ob sie nun aus Fleisch und Blut oder wie bei Čapek aus Metall und Kunststoff sind
Die Rebelliion der ausgebeuteten Arbeiter ist auch ein zentrales Motiv in Fritz Langs 1927 veröffentlichtem Stummfilmklassiker "Metropolis", in der ein humanoider Roboter die Hauptrolle spielt.
Die Robotergesetzte von Asimov
Im Jahr 1920 wurde nicht nur die literarische Figur des Roboters kreiert, sondern wurde auch der amerikanische Science Fiction-Autor Isaac Asimov geboren, der viel zur Popularisierung des Begriffs und Konzepts des Roboters beigetragen hat. Von Asimov stammen vor allem die "drei Robotergesetze", die er erstmals 1942 in seiner Kurzgeschichte "Runaround" formulierte:
1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
2. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen - es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum Ersten Gesetz.
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieses sein Handeln nicht dem Ersten oder Zweiten Gesetz widerspricht.
I,Robot
Bereits ein Jahr zuvor hatte Asimov in seiner Erzählung "Liar!" das erste dieser Gesetze erwähnt und dabei auch den Begriff "Robotics" oder auf Deutsch: Robotik geprägt. 1950 veröffentlichte Asimov seine Kurzgeschichtensammlung "I, Robot", aus der die eine oder andere Idee Eingang in den gleichnamigen Hollywood-Blockbuster mit Will Smith gefunden hat.
In dem Film kommt es - wie schon bei Karel Čapek - zu einem Aufstand der Roboter gegen ihre Schöpfer, die Menschen. Dieses Leitmotiv findet sich auch in anderen Filmen wie etwa "Terminator" oder auch in Fernsehserien wie "Battlestar Galactica": Streng genommen, handelt es sich bei den Robotern in "Battlestar Galactica" wie auch in Karel Čapeks Theaterstück gar nicht um Roboter, sondern um Androiden.
Kybernetische Organismen
Es gibt noch andere Erscheinungs- und Mischformen zwischen Mensch und Maschine: Erwähnt sei auch in diesem Zusammenhang etwa der Hollywood-Film "RoboCop" aus dem Jahr 1987, in dem ein im Dienst tödlich verwundeter Polizist nur überlebt, indem er zur Maschine wird.
Eine originelle Variation des "Mensch wird zur Maschine"-Motivs findet sich in dem Roman "Interface" von Stephen Bury (ein Pseudonym des bekannten SciFi-Autors Neal Stephenson). In dieser SciFi-Polit-Satire werden Meinungsumfragen in Echtzeit und per implantierten Computerchip direkt in das Gehirn des US-Präsidenten eingespeist.
Auch in diesen Fällen handelt es sich eigentlich nicht um Roboter, sondern um "Cyborgs" - kybernetische Organismen. Der Begriff und das Konzept wurden 1960 von Manfred Clynes, einem aus Österreich stammenden Wissenschafter, entwickelt.
Neben Clynes gibt es mit Hans Moravec noch einen weiteren aus Österreich stammenden Wissenschafter, der mit seinen Forschungsarbeiten und Experimenten eine Verschmelzung von menschlichem Körper bzw. Geist mit Maschinen und Computern anstrebt.
Der Unterschied zwischen Mensch und Roboter
Der Mensch der Zukunft könnte also mit der Maschine verschmelzen und selbst, zumindest teilweise, zum Roboter werden. Es gäbe keine klare Trennung zwischen Mensch und Roboter, sondern die Grenzen wären fließend und würden im Körper des Menschen verlaufen.
"Was macht uns zu Menschen? Was unterscheidet uns von Robotern?" - das ist auch das Leitmotiv zahlreicher Romane und Kurzgeschichten von Philip K. Dick.
Dick gab darauf oft überraschende Antworten und oft waren die Androiden und Roboter in seinen Geschichten auch nur Metaphern für Menschen, die ihre menschlichen Eigenschaften und Qualitäten verlieren und immer mehr zu gefühllosen Maschinen werden.
Hör-Tipp
Matrix, Sonntag, 29. Juni 2008, 22:30 Uhr
Links
Karel Čapek
Projekte rund um die Gebrüder Čapek
Philip K. Dick
Isaac Asimov's "Three Laws of Robotics"