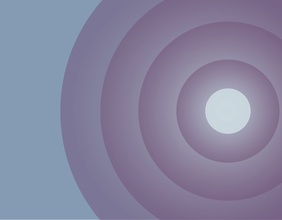Mindestsicherung: Kritik an Regressregelung
Nach der Volksanwaltschaft übt auch die Armutskonferenz heftige Kritik am Vollzug der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Nicht nur werde sie in vielen Fällen nicht ausbezahlt. In Kärnten oder der Steiermark könnten die Behörden das Geld von anderen Familienmitgliedern auch wieder zurückfordern.
27. April 2017, 15:40
Mittagsjournal, 25.2.2014
Regress nach wie vor aufrecht
Vor knapp dreieinhalb Jahren hat die bedarfsorientierte Mindestsicherung die Sozialhilfe abgelöst. Anspruch darauf hat, wer sich den Lebensunterhalt, das Wohnen und die Krankenversicherung nicht leisten kann. Einzelpersonen bekommen 814 Euro im Monat. Mit ihrer Einführung sollte in ganz Österreich auch die Regressregelung fallen. Das ist auch in der so genannten 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern festgelegt.
In der Steiermark und Kärnten ist es aber nach wie vor so, dass Angehörige im Nachhinein Leistungen zurückzahlen müssen, sagt Martin Schenk von der Armutskonferenz. "Beim Regress kann es vorkommen, dass Eltern, die etwa eine Tochter mit sozialen Probleme haben, dieses Geld plötzlich zurückzahlen muss." Die Forderung könne oft mehrere tausend Euro betragen.
Abschreckung für Bezugsberechtigte
Der Regress schrecke aber auch viele hilfsbedürftige Menschen davon ab, die Mindestsicherung zu beantragen. "Alleine die Tatsache, dass die Behörden das Geld von einem anderen Familienmitglied zurückfordern können, stellt schon für viele einen Ausschlussgrund dar", so Schenk.
Vom Regress hält auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) "überahupt nichts". Der Vollzug sei aber Ländersache, ihm fehle bei diesem Thema die Zuständigkeit und auch die Möglichkeit eines finanziellen Druckmittels. Fakt sei aber: "Wo es Probleme gibt, gehören sie aufgearbeitet."
"Fragwürdige Praxis"
In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol gibt es zwar keinen Angehörigenregress mehr, laut Armutskonferenz habe man aber auch dort einen Weg gefunden, Angehörige zur Kasse zu bitten. Die Sozialämter übten Druck auf die Antragssteller aus, ihre Eltern oder volljährige Kinder auf Unterhalt zu klagen. Eine gesetzlich fragwürdige Praxis, kritisiert Schenk.