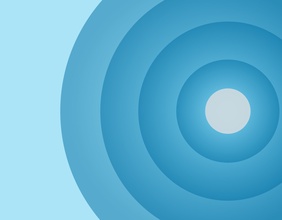Patientenverfügung wenig genutzt
Welche lebenserhaltenden Maßnahmen kann und darf ein Mensch am Ende seines Lebens annehmen - was ist moralisch, und unter welchen Umständen ist es einer Ärztin, einem Arzt zumutbar, nicht helfen zu dürfen. All diese Fragen hat der Gesetzgeber vor fast einem Jahrzehnt geklärt und die Möglichkeit einer sogenannten Patientenverfügung geschaffen: Das bedeutet, dass Menschen - sie müssen noch gar nicht Patienten sein - festlegen, welche medizinische Behandlung sie im Fall des Falles ablehnen. Jetzt stellt sich heraus: Nur wenige Menschen nützen diese Möglichkeit.
8. April 2017, 21:58
Morgenjournal, 16.12.2014
Seit 2006 gibt es diese Möglichkeit. Man geht zum Arzt einerseits und zum Rechtsanwalt, Notar oder Patientenanwaltschaft und unterschreibt das Papier, an das sich dann im Fall des Falles die Ärzte, die Ärztinnen zu halten haben: Dann nämlich, wenn man seinen Willen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausdrücken kann. Ein Satz könnte dann zum Beispiel lauten: "Bei schwerer Dauerschädigung meines Gehirns lehne ich eine Intensivtherapie oder eine Wiederbelebung ab."
Klingt als Möglichkeit der Selbstbestimmung bis hin in die letzten Lebenstage sinnvoll, hat sich aber in Österreich in all den Jahren nicht wirklich durchgesetzt. Denn: Nur vier Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung haben so eine Verfügung erreichtet. Das hat nun das "Institut für Ethik und Recht in der Medizin" an der Universität Wien herausgefunden, repräsentativ und telefonisch befragt wurden 1022 Personen. Studien-Mitautorin Katharina Leitner über die Ursache über die nur mäßige Durchschlagskraft des gut gemeinten Gesetzes: die Errichtung sei mit Kosten verbunden. Man muss einen Arzt konsultieren, dann einen Notar oder Rechtsanwalt, oder kostenlos die Patientenanwaltschaft und dann beglaubigen lassen. Und man müsse viel Zeit investieren.
300 bis 400 Euro können die Gesamtkosten für so eine Patientenverfügung schon ausmachen. Eine weitere Ursache für die bloß vier Prozent sehen die Studienautoren darin, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu wenig darüber wissen. Katharina Leitner sagt, fast alle wüssten, dass es das gibt, aber eine genaue Überprüfung trauen sich nur wenige zu.
Das Gesetz sei aber nicht misslungen, meint das Forschungsteam der Uni Wien. Es gehe um mehr Information und allenfalls mehr Ressourcen für die Patientenanwaltschaften für Gratisberatung.