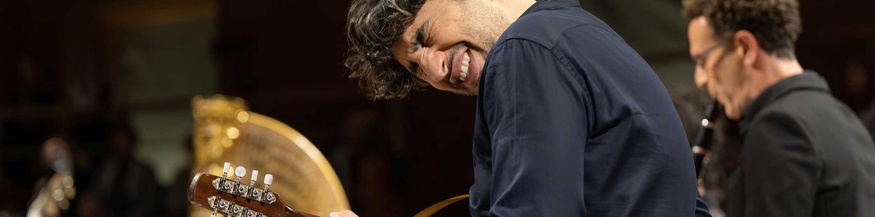ÖNB
Gedanken für den Tag
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm
Der Literaturkritiker und Übersetzer Cornelius Hell anlässlich des 100. Geburtstages von Paul Celan.
27. Dezember 2020, 02:00
Vor 100 Jahren wurde Paul Celan als Paul Antschel geboren, vor 50 Jahren verstarb der Dichter und Schöpfer der berühmten "Todesfuge".
"Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken"
So beginnt Paul Celans berühmtestes Gedicht, die "Todesfuge". Er war 24 Jahre alt als er dieses Gedicht schrieb, nachdem er erfahre hatte, dass seine Eltern in einem Arbeitslager in der Ukraine ermordet worden waren. Das Gedicht wurde weltweit zu einem der bekanntesten des 20. Jahrhunderts.
„Die Todesfuge fasst die Erfahrung eines ganzen Jahrhunderts zusammen: Die Erfahrung der Verfolgung von Millionen europäischer Juden, die das erste Mal dichterisch Gestalt angenommen hat in diesem Text", sagt der deutsche Literaturwissenschaftler Thomas Sparr.
Die Musikalität seiner Verse steht in schreiendem Kontrast zu dem, was es zeigt: den KZ-Aufseher, der seine Rüden herbei- und seine Juden hervorpfeift und sie ihr eigenes Grab schaufeln lässt. Dieses Gedicht ist nicht nur ein großes Kunstwerk, sondern vielleicht das erste präzise Zeugnis des Massenmordes an den Juden, der bei der Entstehung der "Todesfuge" im Jahr 1944 noch in vollem Gang war.
"Weit, in Michailowka, in
der Ukraine, wo
sie mir Vater und Mutter erschlugen: was
blühte dort, was
blüht dort? Welche
Blume, Mutter,
tat dir dort weh
mit ihrem Namen?
Mutter, dir,
die du Wolfsbohne sagtest, nicht:
Lupine."
Paul Celan wurde am 23. November 1920 in Czernowitz geboren, damals gehörte die Stadt zu Rumänien, war aber noch ganz geprägt von der Donaumonarchie. Eine starke Rolle spielte das Judentum, dem auch Celan entstammte. Obwohl seine Bar Mitzwa, mit der ein dreizehnjähriger Jude ins Erwachsenenleben tritt, das letzte Ereignis seiner Biografie ist, das in ungebrochenem Zusammenhang mit der jüdischen Religion steht.
Aber nach der Ermordung der Eltern, seinem Überleben des Arbeitslagers und der Flucht vor der sowjetischen Okkupation nach Bukarest waren ihm die Gesänge der jüdischen Liturgie kostbar. 1947 floh Celan vor der kommunistischen Machtergreifung in Rumänien nach Wien - es war ein gefährliches Unterfangen mit bezahlten Fluchthelfern, wie es heute für viele Menschen ein letzter Ausweg ist. 1948 ging Celan nach Paris, wo er sich in den 1950er Jahren intensiv mit dem Judentum auseinandersetzte.
"Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand."
So beginnt Paul Celans "Psalm" aus dem Gedichtband "Die Niemandsrose".
Immer wieder hat sich Paul Celan in seinen Gedichten auf biblische Texte bezogen. Er war kein gläubiger Jude, doch er wusste um die Nähe von Gedicht und Gebet - auch in seinem Gedicht "Tenebrae", wo er Jesus auffordert, zu den Ermordeten zu beten: "Bete, Herr, / bete zu uns, / wir sind nah". Nach der Shoah war die biblische Überlieferung für Celan ein Leertext, aber ein glühender Leertext, wie er in einem der nachgelassenen Gedichte schrieb.
Für Paul Celan ist das Gedächtnis an die Toten keine Pflicht, sondern kommt aus Liebe und leidenschaftlicher Trauer.