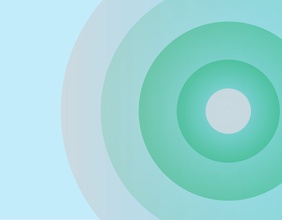Moment am Sonntag
Buchstaben mit Schwung. Die Handschrift. Über Ärzteschriften und Schönschreiben, Kurrent und das Entziffern rätselhafter Notizen. Gestaltung: Paul Urban Blaha, Xaver Forthuber, Marie-Claire Messinger und Alois Schörghuber
3. November 2013, 18:15
Sie wird gleich am Anfang der Schulzeit systematisch erlernt, bald darauf macht sie sich selbständig und schließlich kommt sie in unzähligen Varianten daher. Von manchen wird die Handschrift gehütet und gepflegt wie ein Schatz, von anderen schon totgesagt.
Vom Einkaufszettel bis zum Romanmanuskript, von der Schularbeit bis zum Testament ist sie nach wie vor eine der alltäglichsten Formen des individuellen Ausdrucks - intim und öffentlich, allgegenwärtig und doch von keiner Norm zu bändigen.
Seit Tastaturen und Touchscreens überall leicht zugänglich sind, hat die Handschrift für viele an Bedeutung verloren. Gelehrt wird sie in Gestalt der genormten österreichischen Schulschrift. Lehrer und Lehrerinnen müssen die präzisen Normbuchstaben selbst erst einmal meistern. Und die Norm ändert sich auch von Zeit zu Zeit.
Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts war dagegen die Kurrentschrift die übliche Verkehrsschrift im deutschen Sprachraum und wurde bis etwa 1952 noch parallel zur "runden" Lateinschrift in den Schulen gelernt.
Nach wie vor gibt es Berufe, in denen das Entziffern handschriftlicher Notizen zentral und alltäglich ist. Genauso sprichwörtlich wie die Unleserlichkeit von Arztrezepten ist zum Beispiel die Fähigkeit der Apotheker und Apothekerinnen, diese wieder zu entschlüsseln.
Auch etwa Verleger historischer Briefwechsel können sich in die individuellen Besonderheiten "ihrer" Autoren regelrecht "hineinlesen".