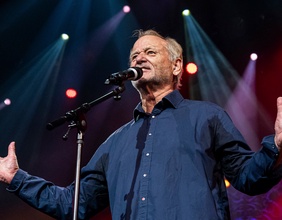Bill Cleggs Memoiren
Porträt eines Süchtigen als junger Mann
Billys Eltern nennen es "das Problem". Der fünfjährige Junge hat immer wieder Schwierigkeiten, auf die Toilette zu gehen. Jedes Wasserlassen wird für Billy zur mühevollen und langwierigen Tortur: Er weiß, es wird brennen, wie Glassplitter, aber er will es endlich hinter sich bringen.
8. April 2017, 21:58
Er tänzelt ungeduldig vor dem Becken, Schweiß tritt ihm auf die Stirn. Wenn der brennende Druck dann endlich überhand nimmt, hört er nichts mehr. Nach einer halben Stunde, im Moment der Erleichterung, bespritzt er die Wand, den Fußboden, die Heizung und sich selbst.
Zitat
"Warum dauert das wieder so lange?", donnert es von draußen. Sein Vater wieder. Sein Vater sagt ihm immer, er soll sich nicht so lange auf dem Klo aufhalten. Der Junge ruft hinaus, dass er gleich fertig ist, einen Moment noch, und dreht den Wasserhahn auf, um die Geräusche seiner Putzaktion zu übertönen. Seine Hose und sein Hemd sind durchnässt von Wasser, von Urin. Er holt tief Luft und wappnet sich für das, was ihn draußen erwartet.
Alles für die Drogen
Das traumatische Blasenproblem seiner Kindheit hat der kleine Junge im Mannesalter zwar hinter sich gelassen, trotzdem kommt Bill Clegg, nun ein renommierter New Yorker Literaturagent, von den Problemen nicht los. Als Erwachsener ist Clegg schwer drogensüchtig, ein von Crack abhängiger Junkie. Im Alter von dreißig lässt Bill Clegg für die Drogen all das zurück, was er sich zuvor aufgebaut hat: seine aufstrebende Literaturagentur, seine erfolgreichen Klienten wie die Autorin Nicole Krauss, und seinen ihn liebenden Lebensgefährten Noah. Stattdessen ändert Bill Clegg seine Prioritäten. Er entscheidet sich, nicht mehr ins Büro zu gehen, die Anrufe seines Freundes zu ignorieren und sich stattdessen voll und ganz den Drogen hinzugeben.
Mit etwa 70.000 Dollar auf dem Bankonto beginnt Clegg einen neuen Lebensabschnitt. Seine Tage und Nächte verbringt er nicht mehr in seiner wohlbehüteten New Yorker Luxuswohnung, sondern in billigen Hotelzimmern mit Strichern, Taxifahrern, Dealern und jedem, der ihn mit neuem Stoff versorgen kann. Wie ein Nomade wechselt Clegg ständig seinen Aufenthaltsort, zieht von Hotelzimmer zu Hotelzimmer und macht die heruntergekommenen Absteigen zu seinen Drogenhöhlen. Dort begeht er Raubbau am eigenen Körper und konsumiert ausschließlich Fast Food, literweise Wodka und raucht Crack.
Grenze überschritten
Die Menschen außerhalb seines Drogenexils interessieren ihn nicht mehr. Gesellschaft für einsame Junkie-Nächte findet er stattdessen in den dunklen Ecken der New Yorker Seitenstraßen, hat mit ihnen ungeschützten Sex und unterwirft sich so einem hypnotischen Rhythmus aus Drogen, Sex und Zerstörung. Irgendwann überschreitet er dabei allerdings unbemerkt eine Grenze: Auf den Straßen fühlt er sich beobachtet, in Hotels wird er immer wieder freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Nun sieht man ihm seine Sucht sogar schon an.
Zitat
Was passiert, steht mir jetzt klar vor Augen - das langsame Abrutschen, das Erreichen des jeweils nächsten unmöglichen Stadiums - Crackhöhle, Entzug, Knast, Straße, Obdachlosenasyl, ein kurzer Schock, dann die Anpassung an die neue Realität. Bin ich jetzt im Fegefeuer zwischen Bürger und Niemand, jungem Gentleman und Penner?
Persönliche Geheimnisse
An dieser Stelle in Bill Cleggs "Porträt eines Süchtigen als junger Mann" ist Clegg ein paranoider, depressiver Junkie nahe am Suizid. Aber Cleggs Buch ist kein fiktiver Roman, es sind die Memoiren eines geläuterten Drogenabhängigen, der damit vom Literaturagenten zum Autor wird.
Bill Clegg teilt seine Drogensymphonie geschickt in zwei Teile: in den ersten, der den Absturz ausführlich schildert, und in einen zweiten, der erklärt, wie es dazu kommen konnte. In diesem erfahren wir auch, wie langsam und schleichend die Sucht größer wurde und wie sich aus dem kleinen Buben mit dem Blasenproblem ein suizidaler Crack-Head entwickeln konnte.
Die beiden Lebensabschnitte scheinen auf den ersten Blick voneinander unabhängig, sind aber Beginn und Ende einer zusammenhängenden Geschichte über die ständige Bewahrung persönlicher und peinlicher Geheimnisse. Als kleiner Bub wird Clegg von seinem Vater für seine Probleme beim Urinieren gehänselt und zurechtgewiesen, das Wasserlassen wird für den Fünfjährigen zum peinlichen Akt, den er vor den Eltern geheim halten will. Als Erwachsener ist es mit der Drogensucht ähnlich: Clegg versucht anfangs die Drogen mit dem Alltag zu verbinden, doch hier kollidieren zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Als Bub konnte Clegg seinen Autoritäten nicht entkommen, als Erwachsener entschließt er sich, zum Aussteiger zu werden.
Die zwei Leben in uns
Zwischen Kindheit und Drogensucht liegt das langsame Herantasten an die Abhängigkeit, immer wieder befördert durch Probleme mit den Eltern, der Krankheit der Mutter, der Autorität des Vaters. Das College muss Clegg abbrechen, weil man bei ihm mehrmals Joints findet. Die Entdeckung seiner Homosexualität ist eine mühevolle Anstrengung, die erneute Sanktionen des Vaters zufolge hat. Die Aussöhnung mit dem Vater: Sie scheint der einzige Schlüssel für den Horrortrip im Leben von Bill Clegg zu sein.
Das Besondere an diesen Memoiren ist nicht nur ihre Sensibilität und Ernsthaftigkeit, sondern auch ihr Schreibstil. Die Rückblicke in seine Kindheit schreibt Clegg in der dritten Person und erzeugt so auf ungewohnte Weise Distanz und Nähe zugleich. Das Echo des Knaben, der Stunden auf dem Klo verbringt, hört man auch noch in den sehr intimen Passagen, in denen Clegg den Leser in heruntergekommene Hotelzimmer führt - Orte, an denen es keinen geregelten Tagesablauf gibt, an denen Vorhänge zugezogen und Handys abgeschaltet werden, und im Flur sich die Wodkaflaschen türmen. Das sind jene Momente, in denen die unausweichliche Sackgasse so präzise und aussichtloslos geschildert wird, dass man kurz vergisst, dass Clegg hier von seinem Leben erzählt.
Das autobiografische Werk ist geprägt von seiner Dualität: von der Zweiteilung des Buches bis hin zu den zwei Leben, die jeder von uns hat - das eine öffentlich, das andere privat. Wenn diese beiden Leben kollidieren, entsteht eine Geschichte wie jene von Bill Clegg. Einen Weltuntergang muss das aber noch lang nicht zur Folge haben, auch das lehrt uns dieses Suchtporträt. Am Ende seiner Memoiren zitiert Clegg dazu eine Stelle von Haven Kimmel: "Wenn es sich anfühlt wie das Ende der Welt, ist es das bestimmt nicht."
service
Bill Clegg, "Porträt eines Süchtigen als junger Mann", aus dem Amerikanischen übersetzt von Malte Krutsch, S. Fischer Verlag
S. Fischer - Porträt eines Süchtigen als junger Mann