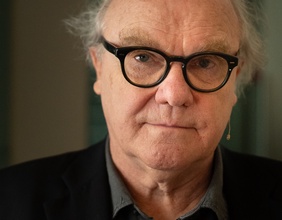AP/ANTONIO CALANNI
Essays
"Mit Fremden sprechen" von Paul Auster
Anlässlich seines 70. Geburtstags im Jahr 1917 hat Paul Auster seinen opulenten, mehr als 1000 Seiten starken Roman "4 3 2 1" veröffentlicht. Im Jahr 2020 erschien ein Band mit Austers besten Essays der letzten fünfzig Jahre. Darin gibt er Einblick in sein Schreiben, porträtiert andere Schriftsteller oder zeigt sich als engagierter Intellektueller, der sich in dringenden Fällen auch direkt an die Politik wendet.
1. Mai 2024, 14:53
Morgenjournal | 18 11 2020
Wolfgang Popp
"Mit Fremden sprechen" - der Titel dieses Best-of-Bandes, war auch der Titel der Dankesrede, die Auster 2006 beim Erhalt des spanischen Prinz-von-Asturien-Preises hielt. Darin denkt er über den Sinn des Schreibens nach, über den Hunger der Menschen nach Geschichten und das Buch als grenzüberschreitende Begegnungszone nach.
Paul Auster: "Ein Buch ist der einzige Ort auf der Welt, an dem sich zwei Fremde ganz nahekommen können. Denn auch wenn tausende Menschen das Buch lesen, hat man doch immer das Gefühl, in einer ganz engen und unsichtbaren Verbindung zum Autor zu stehen."
Vom Essay zum Roman
Paul Auster kennt man mit seiner "New-York-Trilogie", "Die Musik des Zufalls" oder "Leviathan" ja vornehmlich als Autor knifflig konstruierter Romane, dabei hat er als Dichter begonnen, und es brauchte erst einen Umweg, damit er seine Stimme als Romancier fand.
"Bis 22 hatte ich an die tausend Seiten an Geschichten geschrieben, ich war aber nie glücklich damit", erzählt Paul Auster. "Offensichtlich taugte ich einfach nicht zum Romanschriftsteller und beschloss, zur Lyrik zurückzukehren. Dann starb ganz plötzlich mein Vater, und daraufhin schrieb ich mein erstes Buch 'Die Erfindung der Einsamkeit', das halb Autobiografie, halb Essay war, und danach war ich in der Lage, Geschichten zu schreiben."
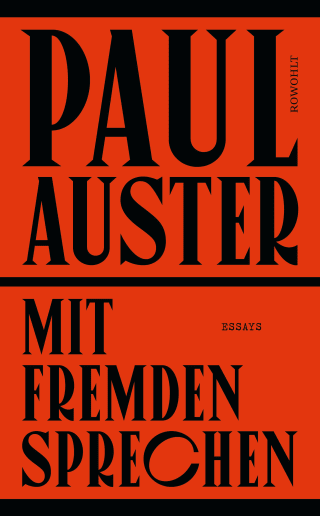
Rowohlt
Treffen mit Beckett
Viel erfährt man über Austers junge Jahre, seine Zeit in Paris etwa, wo er Anfang der 70er-Jahre lebte und als Französisch-Übersetzer vor allem surrealistischer Gedichte arbeitete. Damals kam es, vermittelt durch die Künstlerin Joan Mitchell, zu einem Treffen mit Samuel Beckett.
Was Auster damals vom irischen Nobelpreisträger lernte: Dass auch der größte Erfolg nicht die Unsicherheit vertreibt. Paul Auster: "Wenige Jahre zuvor hatte Beckett den Nobelpreis gewonnen und er war nun gerade dabei seinen Roman 'Mercier und Camier', den er 1946 auf Französisch geschrieben hatte, ins Englische zu übersetzen. Und er sagte damals zu mir, ich habe das Buch um ein Viertel gekürzt, weil es überhaupt nicht gut ist."
Essen mit Dickens, Schreiben im Gehen
In einem anderen Aufsatz erzählt Paul Auster, was er Edgar Allen Poe verdankt, man erfährt, dass er gerne mit Charles Dickens, Dostojewski und Nathaniel Hawthorne zu Abend essen würde, oder dass er sich den besonderen sprachlichen Rhythmus seiner Romane im Gehen erarbeitet.
Gefinkeltes Gedankengewebe
Scharf wird Paul Auster, wenn er sich an die Politik richtet. An den Gouverneur von Pennsylvania, um einen Verbrecher vor der drohenden Hinrichtung zu bewahren, oder an den früheren New Yorker Bürgermeister Giuliani, um für die Freiheit der Kunst zu kämpfen. Das sind aber nur kurze Schlaglichter auf Austers politisches Engagement.
Die wahren Höhenflüge im Buch sind aber die autobiografischen Passagen und die Essays über Schriftstellerkollegen, wo Auster die Fakten genauso gefinkelt zu verweben weiß, wie die Handlungsstränge in seinen Romanen.
Service
Paul Auster, "Mit Fremden sprechen", Essays; aus dem Englischen von Werner Schmitz, Robert Habeck, Andrea Paluch, Alexander Pechmann und Marion Sattler Charnitzky; Rowohlt
Originaltitel: "Talking to Strangers"
Gestaltung
- Wolfgang Popp